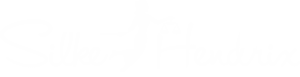Warum eine einvernehmliche Lösung oft besser ist - so trennst du dich von Mitarbeitern
Du willst dich von einem Mitarbeitenden trennen, aber siehst entweder keine Möglichkeit, dies im Rahmen einer Kündigung zu tun oder möchtest sichergehen, dass das Arbeitsverhältnis wirklich aufgelöst wird? Ich zeige dir einen Weg, wie das mittels Aufhebungsvertrag rechtssicher möglich ist.
Warum ein Aufhebungsvertrag eine elegante Lösung zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses darstellen kann, was zu beachten ist und wie ich dich als Anwältin für Arbeitsrecht unterstützen kann, sind nur einige Punkte, die ich im nachfolgenden Artikel näher beleuchte.
Die 3 wesentlichen Unterschiede zur Kündigung
Der Aufhebungsvertrag ist im Gegensatz zur Kündigung eine freiwillige Vereinbarung, die du als Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer schließt. Die Unterschiede zur Kündigung lauten:
- Schließen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag, ist die Einhaltung von Kündigungsfristen nicht notwendig. Das heißt also, dass das Arbeitsverhältnis sogar am gleichen Tag beendet werden kann.
- Als Arbeitgeber musst Du dich bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages nicht an soziale Kriterien, wie bspw. bei einer betriebsbedingten Kündigung halten. Ebenso greift der besondere Kündigungsschutz wie bei Schwerbehinderung, Schwangerschaft oder Elternzeit nicht.
- Der Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in der alle Aspekte, die im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses relevant sein könnten, überwiegend frei geregelt werden können. Der Betriebsrat hat hierbei kein Mitspracherecht.
Wann ist eine einvernehmliche Lösung sinnvoll?
Wenn es schnell gehen muss, ist ein Aufhebungsvertrag das gängigste Mittel, ein Arbeitsverhältnis zeitnah zu beenden. Kündigungsfristen entfallen und der Austritt ist damit zu jedem vereinbarten Zeitpunkt möglich.
Aber wichtiger: Kündigungen sind immer mit einem Unsicherheitsfaktor verbunden. Bei dieser einseitigen Willenserklärung steht es dem Arbeitnehmer frei, nachträglich ein Arbeitsgericht anzurufen und eine Kündigungsschutzklage zu erheben.
Möchtest Du also sichergehen, das Arbeitsverhältnis auch wirklich zu lösen, bietet sich ein Aufhebungsvertrag an. Zwei konkrete Beispiele:
Fall 1: Der Arbeitnehmer mobbt einen Kollegen und stört damit den Betriebsfrieden. Unabhängig davon, dass es sich hierbei durchaus um einen legitimen Kündigungsgrund handeln kann, besteht in diesem Fall die Gefahr, dass die Kündigung vor Gericht nicht standhält. Möchtest du den gekündigten Mitarbeiter worst case in dieser Situation weiterbeschäftigen?
Fall 2: Dein Unternehmen ist aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, Personal abzubauen. Betriebsbedingt zu kündigen wäre sicherlich eine Variante - einen Aufhebungsvertrag zu schließen, aber die aufgrund der Rechtssicherheit elegantere.
Beide Beispiele verdeutlichen, dass der Abschluss eines Aufhebungsvertrages im Vergleich zur Kündigung oftmals der leichtere Weg ist und vor allen Dingen Planungssicherheit gibt.
Kann man einen Aufhebungsvertrag rückgängig machen?
Unterzeichnet ist unterzeichnet oder anders gesagt, wenn kein gesondertes Rücktritts- oder Widerrufsrecht vereinbart wurde, ist der geschlossene Aufhebungsvertrag grundsätzlich bindend.
Nur unter besonderen Umständen ist er anfechtbar bzw. unwirksam. Dazu gehören:
- Einer der Vertragspartner war nicht geschäftsfähig, z.B. aufgrund von Drogenkonsum.
- Es liegt eine arglistige Täuschung vor oder dem Arbeitnehmer wurde widerrechtlich gedroht (§123 BGB)
- Der Arbeitnehmer ist einem (maßgeblichen) Irrtum erlegen, etwa über den Inhalt seiner Erklärung (§ 119 BGB).
- Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns, etwa durch Schaffung einer besonderen Drucksituation durch bewusstes Ausnutzen krankheitsbedingter Schwäche.
Davon abgesehen, dass faires Handeln zum betrieblichen Alltag gehören sollte, nachfolgend ein Tipp, wie und warum du die Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrages mittels Abfindung schmackhaft machen kannst.
Warum die Zahlung einer Abfindung sinnvoll sein kann
In meiner Zeit als Unternehmensjuristin und Personalmanagerin gehörte der Abschluss von Aufhebungsverträgen zu meinen Aufgaben. Ich habe sie oftmals mit der Zahlung einer Abfindung empfohlen. Genau das würde ich dir – insbesondere dann, wenn dein Arbeitnehmer Besonderen Kündigungsschutz genießt oder die Gefahr einer für dich als Arbeitgeber negativ endenden Kündigungsschutzklage besteht - auch raten. Kurz gesagt: Mach ihm den Aufhebungsvertrag schmackhaft!
Warum? Man darf nicht vergessen, dass der Arbeitnehmer mit Unterzeichnung des Aufhebungsvertrages auf relevante Arbeitnehmerrechte verzichtet und dadurch Nachteile in Kauf nimmt.
Bedenke, dass Arbeitnehmer:
- ggf. auf die Einhaltung ordentlicher Kündigungsfristen verzichten
- sich nicht auf Kündigungs- oder ggf. Sonderkündigungsschutz berufen können
- ihre betriebliche Altersvorsorge verlieren können
- u.U. eine Sperre des Arbeitslosengeldes in Kauf nehmen
Möchtest oder musst Du dich also unbedingt vom Arbeitnehmer trennen – mach es diesem leichter und biete den Aufhebungsvertrag zusammen mit der Zahlung einer Abfindung an.
In erster Linie zählt dabei, wie groß dein Bestreben und die Dringlichkeit ist, das Arbeitsverhältnis lösen zu wollen. Die Höhe der angebotenen Zahlung sollte folgende Kriterien berücksichtigen:
- Betriebszugehörigkeit
- Art und Dauer des Kündigungsschutzes
- erwartbare Dauer, eine neue Anstellung zu finden
- Höhe finanzieller Ansprüche wie Provisionen etc.
Neben einer Abfindung gibt es auch andere Möglichkeiten, einen Aufhebungsvertrag auch für den Arbeitnehmer attraktiv zu gestalten, etwa eine bezahlte Freistellung. Diese sollten immer im konkreten Einzelfall besprochen werden.
Die Inhalte des Vertrages
Nachfolgend erläutere ich dir die Inhalte, die ein Aufhebungsvertrag enthalten sollte.
Obwohl du im Internet entsprechende Vorlagen findest, empfehle ich dir, Kontakt zu einem auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalt aufzunehmen. Jeder Fall ist individuell, wie genau du vorgehen solltest und wie du deinen Aufhebungsvertrag für den speziellen Fall rechtssicher und umfassend gestaltest, kann dir ein Anwalt erläutern. Ein Mustervertrag wäre halbherzig und risikobehaftet.
Wichtige Passagen sind aber:
- Der Beendigungstermin, d.h. entweder ein konkretes Datum oder ein in der Zukunft liegendes Ereignis.
- Ausfertigung eines Arbeitszeugnisses – üblicherweise wird ein wohlwollendes, qualifiziertes Arbeitszeugnis vereinbart. Es ist sogar möglich, sich auf genaue Passagen zu einigen.
- Regelungen zur Freistellung von der Arbeitsleistung, wobei es sich um eine optionale Klausel handelt, die im Einzelfall geprüft werden sollte.
- Der Umgang mit Überstunden und Urlaubsansprüchen, die ggf. auch im Rahmen einer Freistellung abgegolten werden können.
- Klarstellungen, welche Vergütungsansprüche noch bestehen sollen, etwa die Zahlung von erst später fälligem Weihnachtsgeld oder Provisionsansprüchen
- Regelungen zur Rückgabe von Firmeneigentum
- Abfindungsanspruch, um etwaige Sperren des Arbeitslosengeldes oder Verluste etwaiger Zusatzzahlungen auszugleichen oder um dem Arbeitnehmer die Annahmen des Aufhebungsvertrages zu erleichtern.
- Die Ausgleichsklausel, welche besagt, dass etwaige gegenseitige Ansprüche abgegolten sind.
Warum ein Aufhebungsvertrag ohne Anwalt möglich, aber nicht sinnvoll ist
Ohne konkrete Veranlassung wirst du als Arbeitgeber keinen Aufhebungsvertrag anstreben, geschweige denn, eine Abfindungszahlung oder ein in der Zukunft liegendes Austrittsdatum mit vorhergehender Freistellung wählen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass zumeist ein gewisser Leidensdruck besteht, sich von einem – meist unliebsamen - Arbeitnehmer trennen zu wollen.
Richtig? Dann geh kein Risiko ein und schwäche deine Verhandlungsposition nicht! Dein Ziel ist die Unterzeichnung und damit Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Mitarbeiter. Berate dich mit einem Anwalt und finde so die beste Verhandlungsposition und Strategie heraus.
In vielen Fällen gibt es keine zweite Chance! Glaube mir - ein vergiftetes Betriebsklima, weil dein Mitarbeiter nun beispielsweise noch unmotivierter ist oder noch öfter grundlos erkrankt, möchtest Du nicht riskieren. Auch solltest du sicherstellen, dass im Aufhebungsvertrag alle wichtigen Punkte geregelt sind und nicht doch noch Monate später ein Streit über Details entsteht, die man eigentlich hätte im Aufhebungsvertrag mitregeln sollen - etwa die Zeugnisformulierung oder den Anspruch auf anteilige Sonderzahlung.